

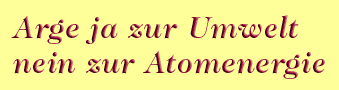
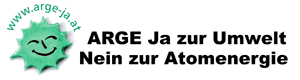
* Archivseite *
(September 2011) Wer denkt sich schon was dabei - zu Mittag, während am E-Herd schon drei Kochplatten und der Backofen im Betrieb sind, warum nicht auch noch schnell die Waschmaschine anschalten, und bis zum Fertigkochen des Essens die Bügelwäsche erledigen. Für die Stromrechnung des Einzelnen macht es im allgemeinen keinen Unterschied, zu welcher Tageszeit der Strom konsumiert wird. Wenn viele Konsumenten in einem Stromnetz gleichzeitig viel Strom verbrauchen, spricht der Stromversorger von einer Strom(bedarfs)- spitze. Spitzenstrom ist teuer, selbst in einem Netz mit konventioneller Energieversorgung, wo in der Form von Erdöl und Erdgas scheinbar unbegrenzte Energiespeicher zurVerfügung stehen, und der Mann im Kraftwerk scheinbar nur das Feuer weiter aufdrehen muß. Tatsächlich läßt sich die Leistung fossiler Kraftwerke nur sehr begrenzt und mit beträchtlichen Effizienzverlusten hinauf- oder hinunterregeln. Das gilt besonders auch für Atomkraftwerke, die Tag und Nacht gleichförmige Mengen Stroms produzieren, egal, ob danach Bedarf besteht oder nicht.
 Erneuerbare Energiequellen andererseits schwanken mehr oder weniger in ihrer Verfügbarkeit.
Die Sonne scheint nicht immer und überall, der Wind bläst hier und nicht dort.
Zeitunabhängig sind nur Wasserspeicherkraftwerke und Strom aus Biomasse.
Manche Energiequellen ergänzen sich gegenseitig, so bläst der Wind mehr
in den sonnenarmen Wintermonaten, während in sommerlichen Flauten Photovoltaikanlagen
Hochproduktion haben. Außerdem fällt deren Leistungsspitze mit der mittäglichen
Bedarfsspitze zusammen.
Erneuerbare Energiequellen andererseits schwanken mehr oder weniger in ihrer Verfügbarkeit.
Die Sonne scheint nicht immer und überall, der Wind bläst hier und nicht dort.
Zeitunabhängig sind nur Wasserspeicherkraftwerke und Strom aus Biomasse.
Manche Energiequellen ergänzen sich gegenseitig, so bläst der Wind mehr
in den sonnenarmen Wintermonaten, während in sommerlichen Flauten Photovoltaikanlagen
Hochproduktion haben. Außerdem fällt deren Leistungsspitze mit der mittäglichen
Bedarfsspitze zusammen.
Der Zweck intelligenter Netze, auch „Smart grids“ genannt, ist, solchen komplexen Verhältnissen gerecht zu werden, indem zusätzlich zum Strom auch Informationen transportiert werden. So kann eine bessere Anpassung des Netzes auf Schwankungen des Energieangebots stattfinden. Dazu gehört nicht nur, das Angebot an den Bedarf anzupassen, sondern vor allem auch, den Stromverbrauch selbst zu steuern, je nach dem, ob Energieüberfluß oder Mangel herrscht. Dabei wird ausgenützt, das zahlreiche stromverbrauchende Geräte ohne nennenswerten Komfortverlust zeitlich flexibel sind. Die Tiefkühltruhe muß nicht unbedingt zur mittäglichen Stromspitze laufen, sie kann auch vorher zwei, drei zusätzliche Minusgrade „Kältereserve“ anlegen, und sich erst wieder nachmittags einschalten. Auch Geschirrspüler und Waschmaschine könnten so programmiert werden, daß sie erst, wenn das Signal für reichlich verfügbaren Strom am Hauszähler eintrifft, dieser mittels spezieller Regeltechnik die Geräte in Gang setzt - mit der Belohnung eines günstigeren Tarifs.
Es geht also darum, Stromverbrauchsspitzen möglichst abzuschwächen, und Stromüberschüsse sinnvoll zu nutzen. Diese Steuerungsprozesse, auf Haushalts- wie auf Netzebene, laufen hochgradig automatisch und selbstregelnd ab. Intelligente Meß- und Steuerungsgeräte („Smart Meters“) können anhand typischer Verbrauchskurven auch den Energiebedarf einzelner Geräte feststellen, was das Identifizieren von Stromfressern erleichtert.Der neue Informationsfluß zwischen Verbraucher und Netzbetreiber bietet Chancen, aber auch Risiken, wie einen weiteren Schritt zum „gläsernen Konsumenten“ bzw. die mißbräuchliche Verwendung der Daten. Deren Anonymisierung ist technisch möglich, muß aber eingefordert und kontrolliert werden.
Besonders interessant wäre bei der in Zukunft erwartbaren Verbreitung von Elektroautos die Möglichkeit, deren Batterien als Pufferspeicher für das Stromnetz zu verwenden. Normalerweise wird ein Auto nur zwei von 24 Stunden am Tag gefahren, in der übrigen Zeit wäre es am Parkplatz mit dem „intelligenten“ Netzkabel verbunden. Je nach Stromangebot könnten die Batterien bis zu einem vom Fahrer bestimmten Maß angezapft oder aufgeladen werden.
Ein Land, das auf dem Weg zu einer erneuerbaren Energieversorgung mit intelligenten Netzen schon weit fortgeschritten ist, ist Dänemark. Während man dort noch 1980 den Energiebedarf mit 16 zentralen Kraftwerken sicherte, kommt man dort heute durch gutes Netzmanagement problemlos mit 20% Windstrom zurecht. An Tagen mit besonders starker Windleistung exportiert Dänemark den Windstrom zu norwegischen Speicherkraftwerken. Österreich ist in der glücklichen Lage, über reichlich Speicherkraftwerke im eigenen Land zu verfügen, und daher für die Zukunft gut gerüstet.