

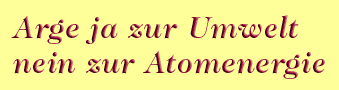
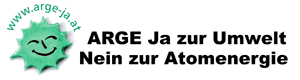
* Archivseite *
Hans Peter-Schmidt (Oktober 2009)
Das Hebräische Wort adamah, von dem sich Adam, der biblische Name des ersten Menschen ableitet, bedeutet Erdboden, was meist fälschlich mit Lehm übersetzt wird. Denn dass Gott den Menschen aus Erde erschuf, hat man sich ganz bildlich als das Formen durch geschickte Hände vorgestellt. Die eigentliche Bedeutung der Geschichte liegt jedoch viel eher darin, dass der Mensch und alles auf der Erde Lebende aus dem Leben des Erdbodens hervorgeht.
 Der Erdboden
lässt sich vielleicht am besten als ein unendlich vernetztes
Wesen verstehen, das aus unzähligen kleinen und kleinsten
Organismen, gebundenen Mineralien, Wasser, Wurzeln und mehr oder
weniger zersetzten Pflanzenstoffen besteht. Fast 90% aller Organismen
unseres Planeten leben im Erdboden und sorgen durch ihr Zusammenspiel
für die Aufrechterhaltung der Lebensprozesse. Höchst
komplex aufeinander abgestimmte Symbiosen sowohl untereinander als auch
mit den Wurzeln der Pflanzen gewährleisten den nahezu
unendlichen Ablauf geschlossener Nährstoffkreisläufe,
bei denen keinerlei Abfälle erzeugt werden.
Der Erdboden
lässt sich vielleicht am besten als ein unendlich vernetztes
Wesen verstehen, das aus unzähligen kleinen und kleinsten
Organismen, gebundenen Mineralien, Wasser, Wurzeln und mehr oder
weniger zersetzten Pflanzenstoffen besteht. Fast 90% aller Organismen
unseres Planeten leben im Erdboden und sorgen durch ihr Zusammenspiel
für die Aufrechterhaltung der Lebensprozesse. Höchst
komplex aufeinander abgestimmte Symbiosen sowohl untereinander als auch
mit den Wurzeln der Pflanzen gewährleisten den nahezu
unendlichen Ablauf geschlossener Nährstoffkreisläufe,
bei denen keinerlei Abfälle erzeugt werden.
Die Pflanzen stehen über ihre Wurzel und deren Exudate (von den Wurzeln abgesonderte Säfte) in unmittelbarer funktionaler Verbindung mit dem Netzwerk des Bodenlebens. So ernähren zum Beispiel die Wurzelexsudate einer ausgewachsenen Rebe in gesundem Boden bis zu 10 Billionen Mikroorganismen, die der Rebe im Tausch gegen Kohlenhydrate wichtige Nährstoffe zuführen, die sie anderweitig nicht aufnehmen könnte. Das äußerst vielfältige Lebensnetz im Boden sorgt sowohl für Nährstoffversorgung und Gesundheit der Pflanzen als auch für den Erhalt und die Stabilität der Böden selbst. Nur wenn die hohe biologische Aktivität der Böden gewährleistet ist und die Stoffkreisläufe sich wieder schließen, werden auch die Humusgehalte der Böden wieder wachsen und damit atmosphärischen Kohlenstoff binden. Um jedoch die Biodiversität landwirtschaftlicher Böden effizient fördern zu können, müssen zunächst einige grundlegende Bedingungen bei der landwirtschaftlichen Produktion erfüllt werden:
Eine hohe Pflanzenvielfalt durch Mischkulturen, Gründüngungen und Strukturmaßnahmen führt ihrerseits zu hoher Insekten-, Tier-, Pilz- und Bakterienvielfalt, was zu verringertem Schädlingsbefall und zu einer allgemeinen Stabilisierung des landwirtschaftlichen Ökosystems führt. Durch intelligent strukturierten Anbau von Sekundär- und Mischkulturen (z.B. Tomaten und Roggen zwischen den Reben) wird es zudem möglich, dass sich die Nahrungsmittelproduktion, die Förderung der Biodiversität und der Anbau von Energiepflanzen als Sekundärkulturen (z.B. schnellwachsende Baumstreifen zwischen Getreidefeldern) hervorragend ergänzen. Diese zwischen den Hauptkulturen angebauten Energiepflanzen ermöglichen die Herstellung von Brenn- und Kraftstoffen sowie von Pflanzenkohle und von Komposten, wobei letztere wiederum der Bodenaktivität und Klimaneutralität zu gute kommen.
Ohne nennenswerte Einbußen an Produktivität und bei gleichzeitiger Förderung der Biodiversität können Klimafarmen neben dem Anbau ihrer Hauptkulturen Energie produzieren und Kohlenstoff aus der Luft in ihren Böden speichern. Mit einer solchen Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktpalette ginge auch eine Minderung des wirtschaftlichen Risikos der Bauern einher. Durch Klimafarming werden die Stoffkreisläufe geschlossen und die landwirtschaftlichen Ökosysteme mittels Biodiversifikation stabilisiert, so dass die Landwirtschaft anstatt den Klimawandel und das Aussterben der Arten zu begünstigen, das Leben und das Klima, die Landschaft und den gesellschaftlichen Wohlstand nachhaltig schützt.
 Das Konzept des
Klimafarmings basiert also zunächst auf einer umfassenden
Förderung der Biodiversität innerhalb der
landwirtschaftlichen Produktion. Zur Unterstützung dieser
Prozesse hat das Ithaka-Institut eine Charta für
Biodiversität im Weinberg aufgestellt, die bereits Grundlage
für die Produktionsrichtlinien vieler europäischer
Winzer ist und sich mit einigen Anpassungen auch auf die Landwirtschaft
im Allgemeinen übertragen lässt. Die 10 Punkte
umfassende Charta reicht von der Reaktivierung der Böden durch
Komposte und artenreicher Gründüngung über
die Anpflanzung von Hecken und Bäumen für vertikale
Diversität bis hin zur Ansiedlung von Wildbienen und
Maßnahmen zum Erhalt der genetischen Vielfalt innerhalb der
Hauptkultur.
Das Konzept des
Klimafarmings basiert also zunächst auf einer umfassenden
Förderung der Biodiversität innerhalb der
landwirtschaftlichen Produktion. Zur Unterstützung dieser
Prozesse hat das Ithaka-Institut eine Charta für
Biodiversität im Weinberg aufgestellt, die bereits Grundlage
für die Produktionsrichtlinien vieler europäischer
Winzer ist und sich mit einigen Anpassungen auch auf die Landwirtschaft
im Allgemeinen übertragen lässt. Die 10 Punkte
umfassende Charta reicht von der Reaktivierung der Böden durch
Komposte und artenreicher Gründüngung über
die Anpflanzung von Hecken und Bäumen für vertikale
Diversität bis hin zur Ansiedlung von Wildbienen und
Maßnahmen zum Erhalt der genetischen Vielfalt innerhalb der
Hauptkultur.
Hohe landwirtschaftliche Biodiversität und der damit verbundene Humusaufbau würden den Anteil der Landwirtschaft am Klimawandel (14%) deutlich reduzieren. Nachhaltig klimapositiv wird die Landwirtschaft jedoch erst dann, wenn es gelingt, Kohlenstoff aus dem Kohlenstoffzyklus herauszuziehen und dauerhaft im Boden zu speichern. Ohne die Industrialisierung, die auf Verbrennung fossiler Brennstoffe basiert, wäre ein geschlossener Kohlenstoffzyklus auf humusreichen landwirtschaftlichen Böden natürlich ausreichend. Angesichts der aktuellen CO2- Konzentrationen in der Atmosphäre wird jedoch eine aktive Reduktion und Speicherung von atmosphärischem Kohlenstoff notwendig, um die Klimaveränderung aufzuhalten und letztlich umzukehren. Da Pflanzen höchst effizient atmosphärischen Kohlenstoff aufnehmen, liegt es nahe, dass die Landwirtschaft diesen natürlichen Prozess nutzt, um durch raffinierende Verarbeitung dieses pflanzlichen Kohlenstoffes zu Kohlenstoffproduzenten und Kohlenstoffsequestrierern zu werden.
Die dafür einzusetzende Technik ist bekannt und verfügbar. Wird Biomasse unter Sauerstoffausschluss auf mindestens 400 Grad erhitzt, brechen die langkettigen Kohlenstoffmoleküle, aus denen die Biomasse besteht, auf. Dabei entsteht neben einem energiereichen Gas so genannte Pflanzenkohle, bei der es sich um reinen, mehrere Jahrhunderte stabilen Kohlenstoff handelt. Der Herstellung und Verwendung dieser Pflanzenkohle kommt bei der Umsetzung des Klimafarming-Konzeptes eine Schlüsselrolle zu. Pflanzenkohle kann aus den Reststoffen der landwirtschaftlichen Produktion, aus den Energiepflanzen der Mischkulturen und ökologischen Ausgleichsflächen ebenso wie aus Grünschnitt und sonstigen biologischen Reststoffen von Gemeinden gewonnen werden. In kleinen, dezentralen Pyrolyseanlagen wie z.B. der 500-KW-Pyreg-Anlage, wie sie u.a. von der österreichischen Firma Sonnenerde verwendet wird, lassen sich jährlich bis zu 3000 Tonnen Biomasse pyrolysieren, was in etwa der Menge entspricht, die bei kleinen Gemeinden anfällt. Während die Abwärme für Biomassetrocknung, Stromerzeugung oder zur Gebäudeheizung verwendbar ist, wird die Pflanzenkohle entweder rein oder mit Kompost vermischt als Bodenverbesserer in die landwirtschaftlichen Böden eingearbeitet. Neben den vielfältigen positiven Eigenschaften, welche die Pflanzenkohle als Bodenverbesserer auszeichnen, wird auf diese Weise stabiler Kohlenstoff in den Böden gespeichert und damit dauerhaft der Atmosphäre entzogen (55 weitere Nutzungsmöglichkeiten von Pflanzenkohle finden Sie im Ithaka-Journal).
Der entscheidende Ansatz bei der klimapolitischen Verwendung von Pflanzenkohle besteht jedoch nicht darin, auf industriellem Niveau Kohle zu sequestrieren, die ja genauso auch als Energieträger verwendet werden könnte und damit andere fossile Brennstoffe ersetzen würde, sondern darin, die agronomischen Vorteilen der Pflanzenkohle und PflanzenkohleSubstrate nutzbar und bekannt zu machen. Wenn die Effekte des Klimaschutzes, für die die Gesellschaft zu zahlen bereit sein wird, und die gleichzeitig erzielten Effekte für die nachhaltige Verbesserung der Böden sowie die damit einhergehende Ertragssteigerung sich gegenseitig befördern, besteht die Chance, dass Pflanzenkohle und Klimafarming dazu beitragen, das Bild der Landwirtschaft grundlegend zu verändern. Um möglichst umfassend die agronomischen Wirkungen und Einsatzmöglichkeiten von Pflanzenkohle zu untersuchen, haben sich Institute, Forscher und Firmen in zahlreichen internationalen, auch von der EU geförderten Projekten vernetzt. Dank dieser fachübergreifenden Zusammenarbeit sollen in den kommenden Jahren alle wesentlichen technischen, chemischen, biologischen, landwirtschaftlichen und klimapolitischen Aspekte der Pflanzenkohlenutzung untersucht und für die praktische Anwendung nutzbar gemacht werden. Das Programm reicht von der Analyse der elementaren Zusammensetzung der Biokohle in Abhängigkeit vom Ausgangsmaterial sowie von den Kenndaten des Pyrolyseprozesses über die Effekte auf die Bodenaktivierung bis hin zu dem Einfluss auf die Qualität der Ernte. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war die Schaffung des Europäischen Pflanzenkohle-Zertifikates (www.european-biochar.org), welches den kontrollierten Einsatz nachhaltig hergestellter Qualitäts-Pflanzenkohle sicher stellt. Die Pflanzenkohle ist keine Wunderwaffe und auch nicht, wie es James Lovelock vor kurzem schrieb, die letzte Hoffnung der Menschheit. Doch da die Pflanzenkohle für eine Reihe ganz verschiedener Probleme unseres Planeten Lösungsansätze bietet, könnte es tatsächlich sein, dass sie am Ausgangspunkt eines umfassenden Wandels der Landwirtschaft und der Begrenzung des Klimawandels steht. Geschehen wird dies allerdings nur dann, wenn die Pflanzenkohleerzeugung und -nutzung sich in ein agronomisches, bioenergetisches und ökologisches Gesamtkonzept eingliedern.
Hans-Peter Schmidt (1972) studierte Philosophie und Film in Hamburg, arbeitete als freier Autor, Journalist, Übersetzer und Lehrbeauftragter. Seit 2005 Aufbau des Versuchsweingutes Mythopia (Schweiz/- Wallis) mit Forschungen in Kulturökologie und Regenerierung landwirtschaftlicher Ökosysteme. Seit 2009 Forschungsleiter des Schweizer Ithaka-Instituts für Ökologie und Klimafarming sowie Herausgeber des Ithaka-Journals. info@ithaka-institut.org Ithaka steht für die Sehnsucht der von der Landwirtschaft vertriebenen Schmetterlinge, Bienen, Libellen, Gottesanbeter, in Zukunft wieder ihre angestammten Lebensräume in den Weinbergen, Wiesen und Feldern zu bewohnen.
Dieser Artikel erschien im IthakaJournal, 2009, S.328-333, ISSN1663-0521. Wir danken dem Autor für die freundliche Abdruckgenehmigung.
www.ithaka-journal.net
Eine Fülle interessanter Artikel!
www.ithaka-institut.org
“Die Forscher des Ithaka Instituts halten keine
Wahrheiten in der Hand und irren bei aller wissenschaftlichen Sorgfalt
öfter, als es der Sehnsucht nach verlässlichen
Wahrheiten entgegenkommen mag. Ihre Arbeit aber fusst auf dem
unerschütterlichen Willen, die menschliche Intelligenz nicht
als Waffe gegen sich selbst zu richten, sondern als Aufruf zu
verstehen, sich für die nachhaltige Entwicklung der
Lebensräume einzusetzen.”
www.mythopia.ch
Bilder, Weinangebot, Informationen