

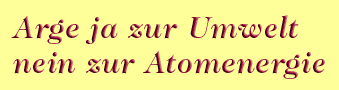
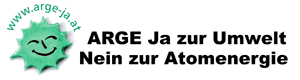
* Archivseite *
Herr Dr. Emde, als engagierter Christ befaßten Sie sich früher vor allem mit spirituellen Themen - seit einigen Jahren aber auch mit wirtschaftlichen Prozessen. Warum?
Mitte der 1990er Jahre fand ich in einer Zeitung ein Diagramm, mit dem die UN-Organisation UNDP auf die wachsende Schere zwischen Reichen und Armen aufmerksam machte. Demnach hatte das reichste Fünftel der Menschheit 1965 einen Anteil von 70% am Welteinkommen – und 1996 einen von 85%. Der Anteil der anderen vier Fünftel hat sich also innerhalb von 30 Jahren halbiert. Vermutlich wird der Anteil dieser vier Fünftel demnächst auf 10% gesunken sein. Es gilt also die Maxime „Wer viel hat, der möge noch dazu nehmen von denen, die wenig haben!“ Kann man sich einen schärferen Widerspruch zur Bergpredigt denken? Dort heißt es: „Wer zwei Röcke hat, der gebe dem einen, der keinen hat!“
Die wachsende Umverteilung führt aber auf Dauer wohl auch zu großen Spannungen und Konflikten?
Verständlicher Weise wird sich das ärmste - und immer ärmer werdende - Fünftel der Weltbevölkerung – immerhin über eine Milliarde Menschen – diese Ungerechtigkeit auf Dauer nicht bieten lassen. Hier liegt die Wurzel des Terrorismus. Menschen, die hungern, sind zum Letzten fähig. Kinder, die aus Armut keine Schule besuchen können und darum keine Berufsperspektive haben, werden sich leichter einer Terrorgruppe anschließen, weil sie dort Essen und Geld bekommen. Zu dieser Entwicklung kann man als Christ nicht mehr schweigen. Deshalb lassen mich zwei Fragen nicht mehr los: „Was ist die eigentliche Ursache für diese unglaubliche Fehlentwicklung?“ und „Wo ist der Hebel anzusetzen, um die wachsende wirtschaftliche Not in der Welt zu lindern?“
Wächst die Umverteilung auch in Deutschland?
Es gibt zwei sorgfältige Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Sie untersuchen die Verteilung der Nettogesamtvermögen - also einschließlich Immobilien und abzüglich Schulden - in den Jahren 2002 und 2007 in Deutschland. Auch hier zeigt sich der Trend zur wachsenden Trennung zwischen Reichen und Armen: Der Vermögensanteil des reichsten Zehntels stieg in diesen fünf Jahren von 57,9% auf 61,1%. Wenn man die Differenz 3,2% auf die Spanne von 30 Jahre - wie in der UNDP-Studie - hochrechnet, kommt man auch hier auf über 15% Reduktion. Noch deutlicher: Die ärmeren zwei Drittel teilen sich heute in weniger als 10% des Gesamtvermögens, während das reichste Hundertstel allein schon mehr als 20% auf sich vereint. Auch im relativ reichen Deutschland findet also der schleichende Prozess einer Verarmung immer größerer Bevölkerungsschichten statt.
Was läuft denn in unserem Wirtschaftssystem falsch?
Unser Wirtschafts- und Finanzsystem besitzt einen Mechanismus, der den erarbeiteten Wohlstand von unten nach oben umverteilt: unser Zinssystem. Um das zu verstehen, muß man sich zunächst klarmachen: Bei jedem Einkauf bezahlen wir einen Zinsanteil mit, denn in allen Preisen sind sog. „kalkulatorische Zinsen“ zur Deckung der Kosten des eingesetzten Kapitals enthalten. Die summieren sich in der Wertschöpfungskette bis zu den Endverbraucherpreisen zu hohen Beträgen auf: im Durchschnitt ist es ein Anteil von rund 40 % der Preise, die wir Bürger bei all unseren Ausgaben mitzahlen. Diese Zinsen landen letztendlich bei den Kapitaleignern, also denen, die so viel Geldvermögen besitzen, daß sie es verleihen können. „Geld anlegen und für sich arbeiten lassen“ nennt man das. So fließt ein ständiger Strom von Zinsen in der unglaublichen Höhe von mehr als 1 Mrd. Euro täglich allein in Deutschland von den Bürgern zu den Kapitaleignern. Das waren 2007 über 400 Mrd. Euro, also weit mehr als der ganze Bundeshaushalt mit seinen 270 Mrd. Euro. Wenn die Bundesregierung über einen großen Teil dieser 400 Mrd. verfügen könnte, ließen sich viele Probleme lösen, unter denen die Mehrheit der Bevölkerung wegen der Knappheit der öffentlichen Kassen leiden muß. Auch die Arbeitslosigkeit ließe sich dann nachhaltig beseitigen.
Union und FDP sprechen gerne von „Neidkampagnen“, wenn diese Umverteilung korrigiert werden soll.
Das hat mit Neid nichts zu tun. Ich würde den Superreichen ihr Vermögen gerne gönnen, wenn es nicht mit der Not anderer Menschen erkauft würde. Deren Milliarden kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern wurden zuerst von anderen Menschen erarbeitet und dann von dort abgesaugt. Das Geld fehlt dort aber. Die Umverteilung führt zur Armut vieler Menschen, und das halte ich in dieser Größenordnung für unverantwortbar.
In der öffentlichen Diskussion werden immer das zu geringe Wirtschaftswachstum, die steigende Arbeitslosigkeit und die steigende Staatsverschuldung als eigentliche Probleme genannt.
Sinkende Einnahmen zwingen den Staat zur Aufnahme weiterer Schulden, wodurch der Sockel an Schuldzinsen immer höher wird. Dadurch wird er unfähig, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, was wiederum die Staatseinnahmen vermindert - ein Teufelskreis! Dieses Problem besteht seit Jahrzehnten, und seit jeher bemüht man sich mit der Parole „Noch mehr Wachstum!“ vergeblich, um eine durchgreifende nachhaltige Besserung. Die eigentliche Ursache liegt in einem grundlegenden Systemfehler, der nicht benannt wird. Um den zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal klar werden, daß das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Ergebnis immer zwischen den Kapitaleignern und den Arbeitenden aufgeteilt wird. Wächst die Wirtschaftsleistung und damit das Volkseinkommen z. B. um 2 %, dann können auch die Kapital- und Arbeitseinkommen jeweils um 2 % zunehmen, ohne daß es zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt. Verlangt aber eine der Beziehergruppen mehr als jene zusätzlich erwirtschafteten 2%, dann muß sich die andere zwangsläufig mit weniger zufrieden geben. Da sich die Wirtschaftsunternehmen heute weit überwiegend mit Fremdkapital finanzieren, müssen sie im Gegenzug Wertsteigerungen erwirtschaften, die dem marktüblichen Zinseszinswachstum entsprechen.
Insgesamt steigen die Geldvermögen und damit die Zinserträge aber ungefähr exponentiell, also jährlich um den gleichen Prozentsatz. Und jetzt kommt das entscheidende Problem: Das BIP kann mit einem solchen Wachstum nicht mithalten. Ein immer schärfer werdender Verteilungskampf zwischen Kapitaleignern und Arbeitenden ist dadurch vorprogrammiert. Die Kapitaleigner haben im heutigen Wirtschaftssystem aber immer den Erstzugriff.
Aber das Wirtschaftswachstum wird doch auch in Prozenten gemessen?
Ja, und auf diese Weise wird verschleiert, daß die Realwirtschaft eine andere Dynamik besitzt wie die Finanzwirtschaft. Im Anschluss an die Währungsreform begann das Wirtschaftsleben in Deutschland in den 1950er-Jahren mit einem niedrigen BIP, aber mit Steigerungen um 8,5 % pro Jahr. Bei solch einem Wachstum konnten Kredite mit 6 % bis 8% Zinsen bedient werden - und es blieb noch Raum für soziale Verbesserungen. In den 1990er-Jahren aber wuchs das BIP real nur noch um rund 1,3 % pro Jahr. Wenn dann die Kapitaleigner einen Rückfluss von 5 % fordern, geht das nur zu Lasten der Arbeitenden: Die Arbeitseinkommen verlieren an Steigung und beginnen relativ zu sinken. - Wer reich ist, dem wächst sein Vermögen über die Verzinsung exponentiell. Wer auf ein Arbeitseinkommen angewiesen ist, wird im Vergleich zur Entwicklung des BIP immer ärmer. Diese Verarmung und ein Abbau von Sozialleistungen werden sogar noch als notwendige „Reform“ angepriesen, um der Wirtschaft das nötige Wachstum zu ermöglichen. Um die exponentiell wachsenden Vermögen mit Zinsen bedienen zu können, müssen die Banken entsprechend hohe Zinsen aus Krediten einnehmen. Da die Nachfrage nach Krediten in etwa aber nur entsprechend dem BIP steigt, also weniger als exponentiell, mußten die Banken versuchen, immer mehr und immer höhere Kredite - notfalls auch an unseriöse Kunden - abzusetzen. So bildete sich die vielzitierte „Kreditblase“, die dann irgendwann einmal „platzen“ mußte.
Nun sind Zinsgutschriften auf dem Sparkonto doch eigentlich etwas Erfreuliches, auf das niemand gerne verzichten möchte?
Natürlich will niemand gerne auf Sparzinsen verzichten, aber hier trügt der Schein. Wenn wir das gesamte Zinsgeschehen betrachten, wird klar, daß es für die meisten Bürger ein Verlustgeschäft ist. 85 % der Haushalte zahlen insgesamt mehr an Zinsen [versteckt in den Warenpreisen, Anm. d. Red.] als sie durch Zinsen einnehmen. So kommen die oben genannten 400 Mrd. Euro zustande, die in die Kassen der oberen 15 % fließen.
Neben den Privathaushalten zahlt auch der Staat viele Zinsen, was zwangsläufig zu höheren Steuern führen muß.
Ja, wir haben einen finanzschwachen, hoch verschuldeten Staat, der schon 2007 jährlich 66 Mrd. Euro [in Österreich 7 Mrd Euro, Anm. der Red] an Zinsen zahlen mußte - 10 % des Staatshaushalts. Wenn er die Steuern erhöht, sinkt entweder die Investitions- und Innovationskraft der Unternehmen oder die Kaufkraft der Bevölkerung. Deswegen wird wohl eher im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, im Umweltschutz und in der Entwicklungshilfe gespart. Die Privatwirtschaft wird sich solcher Aufgaben kaum annehmen, weil sie zu wenig oder keinen Profit abwerfen.
Trotzdem propagieren die etablierten Parteien Wirtschaftswachstum.
Man erhofft sich davon mehr Arbeitsplätze und ein höheres Steueraufkommen. Wie aber soll die Wirtschaft im erforderlichen Maße - also so rasant wie die Vermögen - wachsen, wenn wir schon heute ein Überangebot an Waren haben? (...) Hier zeigt sich auch ein fundamentaler Grundwiderspruch unseres Wirtschaftssystems: Damit die Wirtschaft wächst, fordern die Unternehmen eine Verringerung der Lohnkosten, was aber die Kaufkraft der Bevölkerung reduziert, so daß die Produkte immer weniger Abnehmer finden. Auch die Aufweichung des Umweltschutzes wird gefordert, dabei zeigt der Klimawandel ganz klar, daß wir die ökologischen Grenzen des Wachstums schon längst erreicht haben.
Was machen denn eigentlich die Kapitaleigner mit ihrem großen Reichtum?
Ich vermute, daß viele dieser Superreichen sich persönlich gar keinen so großen Luxus gönnen, sondern nur von der Sucht besessen sind, ihr Vermögen immer weiter zu steigern. Alle drei Jahre macht die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIS) eine weltweite Befragung von Zentralbanken, um das Volumen des täglichen Devisenverkehrs zu ermitteln. Die letzte Erhebung im April 2007 brachte folgendes Ergebnis: Das tägliche weltweite Devisentransaktionsvolumen stieg seit der letzten Erhebung im Jahr 2004 um 69 % auf 3.200 Mrd. US-Dollar! Zum Vergleich: Der internationale Handel beläuft sich täglich auf etwa 60 Mrd. USDollar, das Weltsozialprodukt auf 210 Mrd. US-Dollar. Der Devisenaustausch ist also 56-mal so hoch wie der gesamte weltweite Außenhandel und 15- mal so hoch wie die gesamte weltweite Wirtschaftsleistung! (...) Was könnten stattdessen die Staaten im Interesse ihrer Bürger leisten, wenn sie einen größeren Anteil an diesen - ständig wachsenden - Reichtümern hätten? Welche Folgen hat diese Entwicklung, wenn sie so weiterläuft? (...) Nirgends in der Natur wächst ein Organismus unbegrenzt weiter - nur das Krebsgeschwür, aber auch nur so lange, bis es den Gesamtorganismus zugrundegerichtet hat. (…) Ein unbegrenztes exponentielles Wachstum von Geldvermögen, die Kernidee unseres Finanzsystems, ist also unmöglich länger als einige Jahrzehnte störungsfrei aufrechtzuerhalten, dann wird es notwendigerweise zu einer Währungsreform oder einer sonstigen zerstörerischen Katastrophe kommen. Die Katastrophe kann aber vermieden werden, wenn die Menschheit sich zu einem anderen Wirtschaftssystem entschließt.
Wie könnte ein anderes Wirtschaftssystem aussehen?
Als mich ein Freund zum ersten Mal mit der Zinseszinsproblematik konfrontierte, hielt ich seine Gedanken für Spinnerei. Wenn man den Zinsmechanismus einfach abschafft, dann gibt es doch für die Kapitaleigner keinen Anreiz, ihr Geld zu verleihen, dachte ich. Alles würde stokken, weil es an flüssigem Geld fehlt. Geld muß aber fließen, muß möglichst schnell wieder in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden, sei es durch Einkäufe oder durch Spareinlagen. Die Bank kann das eingelegte Geld dann als Kredit weitergeben. Wenn Geld dagegen gehortet wird, ist es dem Kreislauf entzogen und die Wirtschaft lahmt. Die entscheidende Frage ist darum: Gibt es ein Geldkonzept, bei dem der Zinsfuß auf etwa Null gehalten werden kann und trotzdem ein Anreiz besteht, das Geld anzulegen oder auszugeben, anstatt es zu horten? Silvio Gesell hat dazu in den 1920erJahren ein Konzept vorgeschlagen, das sich in ähnlicher Form vorher schon bewährt hatte und später mehrfach im kleinen Stil erfolgreich praktiziert wurde - bis es verboten wurde. Sein Konzept wird heute meist als „Fließendes Geld“ bezeichnet. Wie funktioniert dieses Konzept? Im heutigen System wird der Kapitaleigner mit Zinszahlungen belohnt, wenn er Geld leihweise zur Verfügung stellt. Nach Gesell sollte er benachteiligt werden, solange er Geld in seinem Besitz festhält. Das könnte konkret heißen: Von seinem Bargeldund Girokontobestand wird täglich ein geringer Prozentsatz als „Geldhaltegebühr“ abgezogen. Spar- und Darlehensverträge sind von dieser Abwertung nicht betroffen. Dadurch besteht ein Anreiz, verfügbares Geld möglichst bald auszugeben oder anzulegen, also als Kredit zu verleihen. Diesem Konzept liegt der Gedanke zugrunde, daß Geld kein Privateigentum ist, sondern der Allgemeinheit gehört, vertreten durch den Staat. Geld muß in Umlauf bleiben, vergleichbar einem Betriebsmittel, einer Fertigungsanlage, die möglichst gut ausgelastet sein muß, um sich zu amortisieren. Darum spricht man auch von „umlaufgesichertem Geld“. Etliche Regionalwährungen benutzen übrigens heute dieses Konzept.
Ist so eine „Geldhaltegebühr“ in der Praxis überhaupt realisierbar?
Das tägliche Abbuchen vom Girokonto kann ganz einfach vollautomatisch von der jeweiligen Bank durchgeführt werden. Auf diese Weise werden auch Scheck- und Kreditkarten in den Prozeß einbezogen. Für Bargeld gibt es verschiedene Realisierungsvorschläge, z.B. eine „subfluente“ Zweitwährung, die in gesetzmäßiger Relation zur Hauptwährung täglich an Wert verliert. Die Zweitwährung erübrigt sich, wenn man sich entschließt, auf die Benutzung von Bargeld zu verzichten und stattdessen mit Geldkarten zu bezahlen.
Das Geld stärker zirkulieren lassen und damit die Wirtschaft ankurbeln - steht das nicht im Widerspruch zum Klima- und Umweltschutz?
Ganz im Gegenteil. Wirtschaftswachstum wird im bestehenden System als die Medizin gepriesen, die uns aus Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung herausführen kann. Dabei erscheinen Umweltschutz und Sozialabgaben als Wachstumsbremsen. - In einem System mit „fließendem Geld“ hingegen wird die Finanzkraft des Staates gestärkt, so daß er für viele Leistungen aufkommen kann, um den Bürgern ein menschenwürdiges Leben in einer intakten Umwelt zu sichern. Denn durch den Wegfall des Zinsanteils sinken die Erzeugerpreise, dadurch entsteht ein Spielraum zur Lenkung des Verbrauchs nach ökologischen und gesundheitlichen Kriterien mittels gezielter Verbrauchsteuern. Und der Staat gewinnt durch diese Steuermehreinnahmen und aus der Geldhaltesteuer die finanziellen Mittel, um sich aus dem Lobbydruck der profitorientierten Wirtschaft zu befreien und seinen ureigensten Aufgaben im Interesse der Bürger nachzukommen. (…)
Wie läßt sich eine Änderung unseres Wirtschaftssystems durchsetzen?
Die großen Parteien haben bei ihrer ureigensten Aufgabe versagt, eine menschenwürdige Ordnung einzuführen. Sie machen sich schuldig, wenn sie weiterhin nur das Heil in hohen Wachstumsraten der profitorientierten Wirtschaft sehen, ein Rezept, das frü- her oder später zur Katastrophe führt. Unsere Wirtschaftsordnung ist nichts Gottgegebenes, sondern von Menschen gemacht. Und darum kann sie auch von Menschen ge- ändert werden. Die Erneuerung wird sicher nicht von denen ausgehen, die heute an den Schalthebeln der Macht sitzen, zumal wenn sie von den momentanen Zuständen persönlich profitieren. Sie werden sich bis zum bitteren Ende an ihre Besitzstände und ihre falschen Ideen klammern. Die Erneuerung muß „von unten“ ausgehen: von Bürgerbewegungen und nicht etablierten Parteien. Es gilt, eine große Menschenmenge zu gewinnen, die wohlüberlegte konkrete Forderungen erhebt. Darüber hinaus halte ich eine ethische Gesinnung für eine wesentliche Voraussetzung, damit eine gewaltfreie Erneuerung unserer Gesellschaft gelingt. (...)
Herr Dr. Emde, herzlichen Dank für das Gespräch!
Mehr zum Thema: Vermögensparade für Deutschland - Bildliche Beschreibung der Vermögensunterschiede