

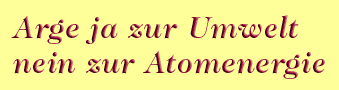

* Archivseite *
Die oben aufgezählten gefährlichen Chemikalien sind nur der Anfang einer Liste, die man noch lange fortführen könnte. Da ist das schwer abbaubare Hormongift Nonylphenol, oder Flammschutzmittel PDBE (polybromierte Diphenylether), die sich heute in vielen Lebensmitteln bis zur Muttermilch nachweisen lassen. Natürlich stammen die Chemikalien in unserer Umwelt nicht nur aus Kunststoffen, sondern auch aus anderen Einsatzbereichen, wie etwa den Pestiziden in der Landwirtschaft. Anläßlich der Präsentation des neuen österreichischen Dokumentarfilms „Plastic Planet“im vergangenen September wurden Freiwilligen unter den Besuchern des Wiener Kinos Blut abgenommen und die beiden Sammelproben (Männer-Frauen) auf die häufigsten Gifte untersucht – und etwa gleich verteilt auch gefunden: Der Weichmacher DEHP, Nonylphenol, auch Bisphenol-A und Flammschutzmittel in geringen Konzentrationen7. Die Umweltorganisation Global 2000 präsentierte gleichzeitig eine Untersuchung, wonach Bisphenol-A im Saugteil von am österreichischen Markt vertriebenen Babyfläschchen enthalten ist8. Niemand ist eine Insel. Wir sind alle betroffen.
Es kann viele Jahre dauern, bis die Langzeitwirkungen selbst von gut erforschten Chemikalien vollständig bekannt werden. Die Risikobewertung von Chemikalien ist auch bisher auf die Untersuchung der Wirkung einer isolierten Chemikalie beschränkt. In der Realität kommt es aber dauernd zu einer Wechselwirkung verschiedenster Stoffe, dem „Cocktaileffekt“, dessen Auswirkungen noch wenig erforscht sind. Besonders besorgniserregend sind Chemikalien, die sich im Körper dauerhaft ansammeln, und solche, die im Körper wie Hormone, die Botenstoffe des Körpers, wirken. Hormonelle Schadstoffe schaffen eine vollständig neue Gruppe von Effekten, wie den Niedrigdosiseffekt: Wirkungen werden bereits bei winzigsten Mengen festgestellt, unterhalb der üblicherweise untersuchten Bereiche, wobei paradoxerweise bei geringen Mengen die Störungen stärker sein können, als bei größeren Mengen. Das würde bedeuten, daß es bei derartigen Chemikalien so etwas wie einen sicheren Grenzwert überhaupt nicht geben kann. Die herkömmliche Risikobewertung, die nach dem Motto “die Menge macht das Gift” Wirkungen unterhalb bestimmter Dosen gar nicht untersucht, könnte daher für solche Substanzen völlig unangemessen sein.
Die meisten Schäden durch hormonelle Schadstoffe entstehen vermutlich in den frühen Entwicklungsstadien, da ein Fötus grundsätzlich viel empfindlicher ist als ein Erwachsener. Störungen des Hormonsystems sind eine der komplexesten gesundheitlichen Bedrohungen, die heute bekannt sind.
Es besteht inzwischen Gewißheit darüber, daß Chemikalien eine Rolle bei der starken Zunahme von Störungen der Fortpflanzungsfähigkeit spielen (50% Reduktion der Spermienzahl in 50 Jahren bei westlichen Männern, 15% der Paare können keine Kinder bekommen). Auch Allergien und Krebsraten steigen alarmierend an. In England wurde eine Verdoppelung der Rate von Hodenkrebs und Brustkrebs innerhalb von nur 25 Jahren festgestellt. Im Zusammenhang mit hormonartig wirkenden Chemikalien (wie Bisphenol-A) wird auch die ansteigende zu frühe geschlechtliche Reife von Mädchen gesehen: In Puerto Rico wurden Fälle von Brustentwicklung schon mit 8 Jahren festgestellt. Als weitere mögliche Folgen gelten: angeborene Mißbildungen, Fehlgeburten, Störungen des Nervensystems und des Verhaltens (insbesondere bei Kindern), Effekte auf das Immunsystem und berufsbedingte Erkrankungen.
„Eine Interessenpolitik, die Schäden erst dann als wahr akzeptiert, wenn diese bereits in großem Umfang
eingetreten sind, steht einer Politik entgegen,
die sich am Vorsorgeprinzip orientiert,
d.h. Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit auch dann einfordert, wenn es wiederholte und nachvollziehbare Hinweise für ein beträchtliches Schädigungsvermögen gibt, auch wenn der letzte Beweis im Detail noch aussteht.
Bei Asbest und Holzschutzmitteln hat Letzteres viele Jahre gedauert, mit gesundheitlichen Auswirkungen, deren Ausmaß erschreckend ist.“
Prof. Dr. Ibrahim Chahoud,
Head of WHO Collaborating Center for Developmental Toxicity, Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Charité Universitätsmedizin Berlin
Der Konsument, der sich durch die Gesetzgebung und Grenzwerte in Sicherheit wähnt, ist tatsächlich nur unzureichend geschützt: Allein in der EU sind an die 100.000 Chemikalien am Markt, von denen nur die wenigsten ausreichend über ihre gesundheitlichen und umweltbezogenen Wirkungen erforscht sind. Die Verwendung liegt letztlich in der Eigenverantwortlichkeit der Industrie. Wozu das führt, sieht man am Beispiel von PAK – weniger als ein Viertel der Produkte halten den Richtwert ein. Ein weiteres Problem ist, daß zahlreiche Inhaltsstoffe von Produkten gar nicht deklariert werden, weil das genaue Rezept der verschiedenen Kunststoffe von den Firmen als Produktionsgeheimnis betrachtet wird. Erst bei stichprobenartigen Laboranalysen zeigt sich, daß manche dieser Produkte gefährliche Substanzen enthalten, wie erst unlängst wieder bei importierten Kinderspielzeug aus China festgestellt wurde (80% des Kinderspielzeugs wird importiert). Im Jahr 2007 trat die neue EUChemikalienverordnung REACH9 in Kraft. Sie schreibt vor:
REACH ist vor allem ein ehrgeiziges Projekt zur Datensammlung und Verwaltung, aber noch zahnlos, was wirkungsvolle Auflagen oder Verbote betrifft. Denn nur knapp ein Drittel der Chemikalien am EU-Markt – 30.000 von 100.000 – werden wegen der Mengenbeschränkung durch REACH überhaupt erfaßt. Doch der Großteil (60%) dieser erfaßten Chemikalien fällt wieder durch den Rost, weil die Industrie dafür nur minimale Informationen liefern muß, die zur Sicherheitsbewertung durch die Behörde in vielen Fällen kaum ausreichen werden. Außerdem wird der Industrie wird bis 2018 (!) Zeit gegeben, Sicherheitsdaten zu den Chemikalien zu liefern. Eine Verpflichung zum Ersatz gibt es ausschließllich für langlebige bioakkumulierende Substanzen. Krebserregende, fortpflanzungsschädliche und andere gefährliche Chemikalien dürfen weiter vermarktet und in Alltagsprodukten verwendet werden, auch wenn bereits Alternativen dazu vorhanden sind – unter Einhaltung „sicherer Grenzwerte“ und durch „adäquate Kontrollen“ durch die Hersteller selbst. Es gibt praktisch keine Haftung der Industrie für die Sicherheit ihrer Produkte. Immerhin sind Firmen verplichtet, Verbrauchern auf Anfrage Auskunft über in einem Produkt enthaltene besonders riskante Chemikalien zu geben, das betrifft ca. 1500 Substanzen. Es gibt auch Stoffe, die nicht unter REACH fallen: Dazu gehören radioaktive Stoffe, Abfall, Wirkstoffe in Pestiziden und Bioziden, sowie in Lebensmitteln und Medikamenten.
Unerträglich ist, daß zahlreiche als gefährlich erkannte Stoffe nicht sofort verboten werden. Auch zeigt die bisherige Praxis in der EU, daß es allein bis zur Einstufung eine Chemikalie als gefährlich ein langer Weg ist. Ausreichend dafür ist nicht ein hinreichender Verdacht, sondern nur, wenn praktisch der letzte Beweis für ihre Schädlichkeit erbracht ist. Dies kann oft viele Jahre dauern, mit katastrophalen Folgen, wie die Erfahrungen mit Substanzen wie Asbest oder DDT gezeigt haben. Das hormonartig wirkende Bisphenol-A zum Beispiel ist trotz zahlreicher alarmierender Studien weiterhin als normal zugelassene Chemikalie eingestuft, und darf ohne Zulassungsverfahren unbegrenzt eingesetzt werden, solange die Aufnahme durch den Menschen den Grenzwert nicht übersteigt.
Eine Forderung von REACH ist, daß Sicherheitsdaten zu Chemikalien nicht mehr von der Behörde, sondern von den Firmen zu liefern sind, also quasi eine Beweislastumkehr: Nicht die Behörde, sondern die Firma hat die Unschädlichkeit eines Stoffes glaubwürdig zu machen. Das hört sich im ersten Moment gut an, aber welche Folgen hat es, wenn in Zeiten leerer öffentlicher Kassen und schrumpfender Budgets für unabhängige institutionelle Studien für die Sicherheit aller Bürger relevante Verträglichkeitsstudien mehr und mehr von einer interessensgeleiteten Industrie selbst beauftragt werden? Wieviele von der Industrie mit einer Studie beauftragte Wissenschaftler wagen tatsächlich, einem Auftraggeber ein negatives Zeugnis für eine Chemikalie auszustellen, wenn das in der Praxis bedeutet, einen schlechten Ruf auf einem Arbeitsmarkt zu riskieren, wo 90% der Jobs von Firmen vergeben werden, und Arbeitsverhältnisse immer flüchtiger werden.
Da das REACH-Abkommen so große Lücken aufweist, könnte Österreich seine Bürger durch eigene Gesetze schützen? Der Spielraum ist sehr gering. Das österreichische Chemikaliengesetz wurde in der Vergangenheit laufend an die EU-Regelungen angepaßt („harmonisiert“), und da EU-Recht in diesem Bereich über nationalem Recht steht, kann eine eigenständige Gesetzgebung nur mehr in Nischenbereichen stattfinden, die vom EURecht noch nicht geregelt sind. Andernfalls könnte Österreich nur im Rahmen seiner Beteilung an dem REACH-Prozessen eine Initiative setzen, oder es müßte ein sogenanntes „Notifikationsverfahren“ einleiten, in dem der Gesetzesvorschlag der EUKomission und den Mitgliedsstaaten präsentiert wird, und nach frühestens einem halben Jahr eine Mehrheitsentscheidung über die Annahme oder Ablehnung getroffen würde.
Bei einem Anruf beim österreichischen Gesundheitsministerium bezüglich der Chemikalie Bisphenol-A wird klar, daß man die Sache dort - sagen wir mal - gemütlich sieht. Ja, im vergangenen September, als Global2000 die Chemikalie im Saugteil von Babyschnullern gefunden habe, sei der öffentliche Wirbel groß gewesen. Wegen Zweifel an den Ergebnissen habe man darauf eine weitere Untersuchung in Auftrag gegeben und wartet Mitte Februar noch immer auf die Ergebnisse. In einem halben Jahr werde in Kanada ein großer Kongress stattfinden, wo man mit den besten Wissenschaftlern das Thema erörtern würde. Also abwarten und Tee trinken, und dabei darüber philosophieren, wieviele weitere Studien mit beunruhigenden Ergebnissen man eigentlich braucht, um endlich aktiv zu werden, und ob Gesundheitspolitik eine Reaktion auf unübersehbare Schadensfälle ist, oder eher etwas mit Vorsorge zu tun haben sollte. Wenn dann, irgendwann, die Überzeugung gereift ist, daß da Handlungsbedarf wäre, muß man erst abwarten, was die anderen EU-Mitglieder sagen, denn ohne die Chance eines Konsens braucht man die langwierige Maschinerie des Weges durch die Institutionen gar nicht anwerfen.
Überall in der Wirtschaft heute hat man begriffen, daß klare Verantwortlichkeiten und übersichtliche Strukturen unerläßlich für Effizienz sind. Diese Praxis ist im EUVerbraucherschutz auf den Kopf gestellt, die Struktur ist riesenhaft, zu viele sind beteiligt, niemand ist verantwortlich, die Entscheidungsprozesse ziehen sich endlos in die Länge. Einzelne, noch so ambitionierte Beamte müssen in diesem System wohl das Gefühl bekommen, einen Berg mit der freien Hand verrücken zu wollen. Prinzipiell wäre ein europaweites Abkommen zur Erfassung, Bewertung und Regulierung von Chemikalien sehr sinnvoll, insofern in Europa die meisten Chemikalien weltweit produziert werden, und bessere Sicherheitsstandards sich auch auf andere Teile der Welt vorteilhaft auswirken würden. Allerdings sollten dann die Vereinbarungen als europaweite Minimalanforderung betrachtet werden, die einzelnen Länder die Freiheit lassen, jederzeit rasch und effizient individuell strengere Verordnungen vorzuschreiben. Dann könnten „Avantgarde-Länder“ auch einen wichtigen Impuls bzw. Sogwirkung für den Rest der EU ausüben. Nichts spricht dagegen, außer daß in der EU das „Gesetz des freien Warenverkehrs“ das erste. Gebot ist, Einfuhrverbote vor allem die großen Konzerne treffen würden, und daher solche „Diskriminierung von Marktteilnehmern“ zur Todsünde erklärt ist.
Wie in so vielen Bereichen des Lebens heute, steht der Profit über allem: Einflußreiche Lobbies der Industrie verhindern, daß man ihr mit Verboten oder strengen Auflagen wehtut – auf Weh und Kosten der Allgemeinheit. Doch es gibt ein Gesetz, das höher steht als alle Gesetze des Marktes: Der Vorrang des Allgemeinwohls, das durch nichts und gar nichts eingeschränkt werden kann. Das ist unser aller Menschen Recht! Eine mutige Politik wäre notwendig, die das Bekenntnis dazu nicht nur zum Stimmenfang mißbraucht, sondern endlich entschieden umsetzt. Alle anderen Interessen haben sich dem unterzuordnen, und alle Verträge, die dazu im Widerspruch stehen, sind Unrecht und daher zu ändern oder aufzulösen.
Teil 3: Tipps zum Umgang mit Plastik, Zukunftsperspektive Bioplastik
